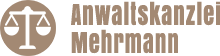In den letzten Monaten hatte ich die Gelegenheit, den AC 1892 Weinheim e.V., einen Mehrspartensportverein mit über 6.000 Mitgliedern, bei der Ausarbeitung einer neuen Vereinssatzung zu unterstützen. Besonderheit dabei war das Delegiertensystem des Vereins und der Ansatz, die im Verein gelebte Praxis individuell in der Satzung darzustellen.
Gestern wurde diese im Rahmen der Delegiertenversammlung verabschiedet – ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Vereins. Die konstruktive Diskussion und die fast einstimmige Zustimmung zeigen, wie wichtig eine gut vorbereitete Satzungsänderung unter Begleitung eines Rechtsanwalts ist.
Doch was sollten Vereine beachten, wenn sie ihre Satzung ändern möchten? Nachfolgend erläutere ich die wesentlichen Punkte.
Rechtliche Grundlagen und formale Anforderungen
Eine Satzungsänderung ist kein einfacher Prozess, sondern erfordert die Einhaltung strenger gesetzlicher und satzungsgemäßer Vorgaben. Grundsätzlich ist das zuständige Vereinsorgan – meist die Mitgliederversammlung – für die Beschlussfassung zuständig (§ 33 BGB). Dabei müssen folgende Schritte beachtet werden:
- Ankündigung: Die geplanten Änderungen müssen fristgerecht mit der Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt werden. Die Tagesordnung muss konkret benennen, welche Satzungsbestimmungen geändert werden sollen. Allgemeine Formulierungen wie „Sonstiges“ reichen nicht aus.
- Beschlussfassung: Je nach Satzung ist eine bestimmte Mehrheit erforderlich (z. B. einfache Mehrheit oder Dreiviertelmehrheit). Bei Zweckänderungen ist sogar Einstimmigkeit notwendig, es sei denn, die Satzung sieht eine abweichende Regelung vor. Wichtig ist auch, eine Beschlussfassung dazu, dass der Vorstand nachträglich redaktionelle Änderungen vornehmen kann
- Protokollierung: Der genaue Wortlaut der beschlossenen Änderungen sowie das Abstimmungsergebnis müssen im Protokoll festgehalten werden.
- Eintragung ins Vereinsregister: Die Änderung wird erst rechtswirksam, wenn sie beim zuständigen Amtsgericht eingetragen wurde. Hierfür sind notarielle Beglaubigungen und eine ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich.
Vorbereitung und Prüfung
Eine gründliche Vorbereitung ist essenziell, um spätere Beanstandungen zu vermeiden. Dazu empfiehlt sich die frühzeitige Hinzuziehung eines Rechtsanwalts.
Oft liest man, dass schon vor der Abstimmung über die Satzungsänderung eine Abklärung mit Finanzamt oder Registergericht erfolgen soll, um z.B. sicherzustellen, dass die Gemeinnützigkeit anerkannt wird oder anerkannt bleibt. Dies ist aber nur bei sehr ungewöhnlichen Vereinszweckänderungen oder dann zu empfehlen, wenn man sich nicht durch einen Rechtsanwalt hat beraten lassen.
Häufige Fehlerquellen
In der Praxis treten immer wieder Probleme auf, die zu Verzögerungen oder gar Ablehnungen führen können:
- Unklare Ankündigung: Wenn die Änderungen nicht präzise in der Einladung zur Mitgliederversammlung benannt werden, kann der Beschluss unwirksam sein.
- Fehlende Protokollierung: Ohne ein ordnungsgemäßes Protokoll verweigert das Registergericht die Eintragung.
Unzureichende Mehrheit: Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, ist die Änderung ebenfalls hinfällig. - Fehlende Gemeinnützigkeit: Änderung von Regelungen, die für die Gemeinnützigkeit relevant sind. Dies ist insbesondere bei Änderungen oder Erweiterungen des Vereinszwecks relevant.
- Unklare Formulierungen: Unpräzise oder mehrdeutige Formulierungen in den geänderten Satzungspassagen können zu Interpretationsproblemen führen und in der Auslegung zu unwirksamen Regelungen führen.
- Nichtbeachtung der Mustersatzung: Gemeinnützige Vereine sollten bei jeder Satzungsänderung prüfen, ob die neue Fassung weiterhin mit der Mustersatzung nach § 60a Abgabenordnung vereinbar ist. Eine Abweichung kann zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen.
Beschlussfassung
Folgende Beschlussfassung ist möglich, wenn der zu verabschiedende Satzungstext bereits mit der Ladung übersandt wurde und in der Mitgliedersammlung noch Änderungen daran beschlossen werden:
die Mitgliederversammlung beschließt
die Neufassung der bisherigen Satzung/ von § X der Satzung des Vereins auf Grundlage des mit der Einladung übersandten Satzungsentwurfs vom XX.XX.XXXX
mit folgenden Änderungen:
§ X Ziffern X des Satzungsentwurfs vom XX.XX.20XX werden durch folgende geänderte Fassung ersetzt: (…)
Zusätzlich sollte immer noch ein sogenannter „Vorratsbeschluss verabschiedet werden:
Der Vorstand wird ermächtigt, an dem unter TOP X beschlossenen Satzungsentwurf Anpassungen vorzunehmen, soweit diese zur Eintragung des Satzungsentwurfs in das Vereinsregister nach Vorgaben des Registergerichts notwendig sind sowie für den Fall, dass diese nach den Vorgaben der zuständigen Finanzverwaltung zum Erhalt des Status als steuerbegünstigt notwendig sind. Die Änderungskompetenz des Vorstands umfasst redaktionelle Änderungen sowie materielle Änderungen, soweit diese den Charakter der jeweiligen Satzungsregelung nicht wesentlich verändert.
Besonderheiten bei Zweckänderungen
Die Änderung des Vereinszwecks stellt eine Sonderform dar und erfordert besondere Aufmerksamkeit:
Alle Mitglieder müssen zustimmen, auch jene, die nicht an der Versammlung teilnehmen. Eine nachträgliche Zustimmung muss ausdrücklich eingeholt werden. Alternativ kann in der Satzung geregelt werden, dass eine reduzierte Mehrheit ausreichend ist (§ 40 BGB).
Aber: Nicht jede sprachliche Anpassung des Satzungszwecks ist auch gleich eine Änderung des Vereinszwecks. Hier muss jeder Einzelfall gesondert geprüft werden.
Fazit
Die erfolgreiche Neufassung der Satzung des AC 1892 Weinheim e.V. zeigt: Mit einer sorgfältigen Vorbereitung und klaren Kommunikation lassen sich auch komplexe rechtliche Prozesse meistern. Eine zukunftsfähige Satzung bildet das Fundament für die Weiterentwicklung eines Vereins und sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.